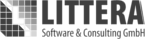- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | ||
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung |
Tagebücher
Klemperer, Victor, 1999| Medienart | Buch |
| Verfasser | Klemperer, Victor
|
| Beteiligte Personen | Nowojski, Walter [Hrsg.]
|
| Beteiligte Personen | Klemperer, Hadwig
|
| Systematik | GE.NS - Geschichte - Nationalsozialismus |
| Schlagworte | Drittes Reich, Judenverfolgung, NS-Verbrechen, Tagebücher, Augenzeuge |
| Verlag | Aufbau Taschenbuch |
| Ort | Berlin |
| Jahr | 1999 |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 1. Aufl. |
| Sprache | deutsch |
| Annotation | Im ausführlichen Tagebuch zeigt sich Klemperer als genauer, kritischer aber auch selbstkritischer Beobachter seiner Zeit und seines Milieus. Während der Zeit der Weimarer Republik betrafen Klemperers Beobachtungen vorwiegend seine wissenschaftliche Karriere und die zahllosen Intrigen an der Universität, beispielsweise die Konkurrenz zu Ernst Robert Curtius. Weiter schrieb er viel über die Beziehung zu seiner ersten Frau Eva, die oft kränklich war, beschrieb Personen und Landschaften, notierte auch eifrig die häufigen Kinobesuche. Aufmerksam verfolgte er sein eigenes gesundheitliches Befinden und die Fortschritte seines wissenschaftlichen Schreibens. Häufig wurde er von Selbstzweifeln heimgesucht. Klemperer äußerte sich auch offen über die Probleme seiner Existenz als konvertierter Jude und vermerkte den nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs im Zusammenhang mit der Dolchstoßlegende und den Wirren um die bayrische Räterepublik virulent um sich greifenden Antisemitismus. Ab 1933 lässt sich mitverfolgen, wie Klemperer langsam und systematisch ausgegrenzt wurde, zunächst nur in der Wissenschaft, später auch im privaten Leben. Klemperers Tagebücher aus der NS-Zeit sind Zeugnis einer Atmosphäre großer und immer größer werdender Angst, in der Klemperer und die anderen Bewohner des „Judenhauses“ lebten: vor allem Angst vor der Gestapo. Gegenüber den häufigen Notizen über antisemitische Äußerungen während der Weimarer Republik vermerkt Klemperers Tagebuch aber eine trotz oder wegen der offiziellen antisemitischen Politik zunehmende Höflichkeit der nichtjüdischen Bevölkerung gegenüber den durch den gelben Stern stigmatisierten Juden – eine Höflichkeit, die natürlich in Bezug auf die Vernichtungspolitik konsequenzenlos blieb. Die Tagebücher wurden ab 1996 im Aufbau-Verlag veröffentlicht und waren ein großer verlegerischer Erfolg. Die Tagebücher der Jahre 1933 bis 1945 gelten heute als wichtiges Dokument der Zeitgeschichte und sind Standardwerke für den Geschichts- und Deutschunterricht. Auch die Tagebücher aus der Weimarer Republik und aus der Zeit nach 1945 beeindrucken als Dokumente eines unbestechlichen Beobachters, der auch nicht davor zurückscheut, den eigenen Ehrgeiz oder die „lingua quarti imperii“ (LQI – den Jargon der neuen kommunistischen Machthaber) kritisch zu thematisieren |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1933 - 1934 (Band Band) |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1935 - 1936 (Band Band) |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1937 - 1939 (Band Band) |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1940 - 1941 (Band Band) |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1942 (Band Band) |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1943 (Band Band) |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1944 (Band Band) |
| Stücktitel | Klemperer, Victor - Tagebücher 1945 (Band Band) |