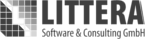| Annotation |
Befreien vom Kriegsgesetz Hans Höllers Handke-Biographie Einen Traum, den der 21jährige Peter Handke seiner Mutter in einem Brief mitteilt, setzt der Salzburger Germanist Hans Höller wie ein Motto an den Anfang seiner Handke-Biographie. Mit Freuds Diktum, dass der Traum die "via regis" ins Unterbewusste sei, betreten auch wir, die Leser, diesen geheimnisvollen Königsweg, und ahnen noch nicht, wohin er uns führen mag. Also treten wir über diese Traum-Schwelle in Handkes Kosmos ein. Höller nimmt auf die Traumerzählung des jungen Handke in der Abfolge der Kapitel immer wieder Bezug, sie wird roter Faden und zugleich Fokus seines Blicks. Von diesem Traum verzweigen sich auf kunstfertige Weise sowohl die Wege zu Handkes Familiengeschichte wie die zu seinen Lebensstationen, und natürlich auch jene zum Verständnis seines vielgestaltigen Werks. Ein eigenwilliger und doch schlüssiger Auftakt für eine biographische Studie, wie sich zeigen wird. Der Kern dieses Traums, den der Grazer Jusstudent Peter Handke am 13. Jänner 1963 träumte, ist die Verwandlung in einen anderen: Handke übernimmt in diesem Traum die Rolle seines Onkels Gregor, der (wie auch sein Onkel Hans) 1943, ein Jahr nach Handkes Geburt, an der sogenannten Ostfront, in Russland, gefallen ist. Er erlebt im Traum nun des Onkels Angst als Soldat auf dem Schlachtfeld und entscheidet sich, gemeinsam mit seinem (realiter ebenfalls gefallenen) Bruder Hans zu desertieren. Aber auf dem Fluchtweg, der sie retten könnte, werden sie von einer immensen Wolken- und Lichtwand geblendet, Angst wird spürbar, dass man dem heulenden Elend nicht entkommen wird können. Das Ende bleibt offen, aber die Flucht vor dem Feind wurde gewagt. Aus dem "Kriegsgesetz" ausbrechen zu können, so begreift Höller Handkes Sehnsucht, er spricht von einem "Tiefenmuster", sieht darin den wesentlichen Schreibimpuls des Autors. Schon auf den ersten Seiten, wir sehen die Familie während des Kriegs, das "Trauerhaus" in Griffen, zieht Höller die Fäden in diesem Gewebe, denn der Traum spielt auch eine wesentliche Rolle in Handkes erstem Roman "Die Hornissen" (1966). Je weiter die Lektüre dieses Buches fortschreitet, sehen wir, dass sich das, was in der Traumgeschichte zugrunde gelegt ist, im Gesamtwerk in Varianten spiegelt. Obwohl man dieses doch kaum als homogen bezeichnen kann. Mit den Bildern des Krieges, den frühen Prägungen des Kindes durch den Nachkrieg, Reisen nach Berlin und wiederholte Rückkehr nach Kärnten, der Geschichte der beiden Väter, dem Ziehvater und dem tatsächlichen Vater, von dem Handke erst als 18jähriger erfährt, beide waren deutsche Soldaten, beginnt dieses Buch. Nach 130 Seiten endet die biographisch-monographische Erzählung wiederum mit einem großen Kapitel über den Krieg. Der Schrecken des Krieges bildet den großen Rahmen für Höllers Biographie, und es ist natürlich verblüffend zu sehen, dass Handke bei den Büchern, den Berichten über seine Jugoslawienreisen auf Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgreift. Mit großer Detailgenauigkeit (überproportional in der Relation zu weiteren Lebensabschnitten Handkes, weil darüber nicht so viel bekannt ist) schildert Höller Kindheit und Jugend, die Internatsjahre in Tanzenberg, das Schulende in Klagen Anfänge als Autor, er verweist auf Handkes Arbeiten für den Rundfunk in Graz, die Lektüre der Autoren der "Kritischen Theorie" der "Frankfurter Schule", des Marxismus. Danach sehen wir im Zeitraffer die Stationen der kometenhaften Karriere des jungen Dichters, das kennen wir schon: Forum Stadtpark, der rasante Start im Suhrkamp-Verlag, der Erfolg des ersten Romans "Die Hornissen", der Auftritt in Princeton, triumphaler Einstieg auch in die Welt des Theaters, die ersten Stücke "Publikumsbeschimpfung" und "Kaspar", sprachanalytische Sprechstücke, Gedichte, Essays zum Theater, Kommentare zu Literatur und Politik um 1968 - und innerhalb von ein paar Jahren war der schüchterne Junge aus Kärnten ein Popstar des deutschsprachigen Feuilletons geworden. Je weiter man in diesem Band die Entwicklungen des literarischen Werks verfolgt, die knappen Informationen über die Lebensabschnitte in Deutschland, Salzburg, Paris liest, desto schlüssiger erscheint Höllers Methode, das Werk Handkes als ein Ganzes, als Einheitliches zu begreifen, als eine einzige große Lebensbehauptungsanstrengung, deren Energiequelle in der Kindheit und Jugend zu finden ist. Ein Anderer zu werden, das bedeutet ja auch, sich auf die "Stunde der wahren Empfindung" vorzubereiten, den "Bildverlust" rückgängig zu machen, sich zu verwandeln, in Parzival oder Don Juan. Also zieht Höller, um ein Beispiel zu geben, von "Kaspar" (1968) verbindende Verweise quer durchs dramatische Werk zu Parzival ("Spiel vom Fragen", 1990) bis hin zum bisher letzten Stück "Spuren der Verirrten" (2007), obwohl es sich dabei doch um sehr unterschiedliche dramaturgische Modelle und Theaterauffassungen handelt. Was die Lektüre dieser Biographie, wie schon bei Höllers großartigen Rowohlt-Bändchen über Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann (damals waren noch 160 Seiten zur Verfügung!) so eindringlich und erhellend macht, ist der Umstand, dass der Verfasser gleich eine Serie eigenständiger Thesen nebeneinander vorträgt. Und ihre Fäden bis zum Ende immer wieder hoch ziehen und neu verknüpfen kann. Wir werden über so vieles neu informiert und folgen staunend den vielen kleinen Seitenwegen der Argumentation, mit denen man bei Handke, den man doch ein wenig zu kennen glaubte, niemals gerechnet hätte. Höller unternimmt Abschweifungen zu Baruch Spinoza, Johann Wolfgang von Goethe, Jean Améry, Franz Kafka, Ödön von Horváth oder zu Bertolt Brecht. Das raffinierteste Kapitel ist wohl der Exkurs über Handke und Walter Benjamin, bei dem nicht nur eine Theorie der "Schwelle" zu finden war, sondern auch ein besonderer "Begriff der Geschichte", wie Höller nachweist: "Benjamins Passagen-Werk |